
Das ist schon heftig. Nix Zarge und Boden (was bei spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Instrumenten durchaus schon der Fall war, wie ich gerade recherchiert habe) - der massive Korpus wird "einfach" ausgehölt und dann kommt die Decke drauf. Ist natürlich sehr stabil und gibt einen massiven Ton, schwingt dafür auch weniger und ist mehr Arbeit. Der kurze Hals und die Kopfplatte sind ebenfalls gleich mit dran, was ebenfalls für Stabilität sorgt. Allerdings ist dann wohl definitiv ein aufgesetztes Griffbrett fällig. Die historischen Vorbilder hatten das laut dem Artikel scheinbar nicht alle. Jedoch ein Holz zu finden, das stabil genug für den Korpus ist und sich auch als Griffbrett eignet, dürfte nicht leicht sein. Vermutlich hat man da einfach die Klangeinbußen hingenommen. Mich würde wirklich interessieren, welche Hölzer damals zum Einsatz kamen. Diese Angabe vermisse ich irgendwie in dem Artikel (oder gucke ich scheel?).
Auch die Mechaniken würden mich interessieren. Auf den Bildern sind meist Punkte oder Stifte zu erkennen, zu denen die Saiten (vermutlich aus Sehne oder Darm) führen. Aber nur weil die Saite daran befestigt ist (vermutlich gewickelt), kann man noch nicht stimmen. Also muss der Stift drehbar sein, folglich eine Mechanik haben. Gelegentlich kann man Flügelköpfe hinein interpretieren (z. B. Bild 2 & 3), aber vielleicht ist auch ein Stimmschlüssel zum Aufsetzen benutzt worden. Die Repliken haben alle Flügelmechaniken, die auf die Kopfplatte aufgesetzt oder hineingebaut sind. Moderne Mechaniken an Gitarren, die ich halt kenne, haben Schneckengewinde, aber die kann man bei mittelalterlichen Instrumenten sicher ausschließen. Wie sieht das bei modernen Streichinstrumenten aus - weiss das jemand? Ich frage mich, wie diese alten Instrumente die Stimmung hielten. Allein durch den Saitenzug?

Das kann nur eher schlecht als recht funktionieren.
Im Text ist erwähnt, dass einige der historischen Instrumente keine Brücke zu haben scheinen, da diese nicht zu sehen ist. Das glaube ich nicht. Ich tippe eher auf mangelnde Detailgenauigkeit bei der Darstellung der Instrumente. Andernfalls wäre die Intonation wohl zu sehr beeinträchtigt. Okay, wir haben einen Steg, der die Saiten anhebt und unter Spannung setzt, aber am oberen Griffbrettende würden die Saiten vermutlich doch zu flach aufliegen, trotz der kurzen Mensur. Zudem wären die Saitenabstände nicht gewahrt. Die Repliken haben dann bezeichnender Weise auch alle Brücken.

Interessant finde ich auch, dass bei modernen Nachbauten, die ich auf anderen Seiten gefunden habe, vermehrt Bünde in das Griffbrett gesetzt werden. Das lässt darauf schließen, dass man diese Instrumente dann eher zupft und weniger streicht.
Ich kenne Bilder von alten Gitarren aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die ich sehr spannend finde. Das hier schlägt in die gleiche Kerbe. Besonders dieses Exemplar hat es mir angetan:

 Übersicht
Übersicht

 Hilfe
Hilfe

 Suchen
Suchen

 Einloggen
Einloggen

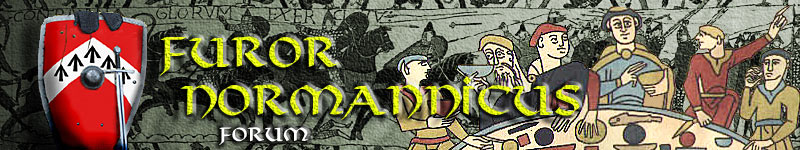
 Übersicht
Übersicht

 Hilfe
Hilfe

 Suchen
Suchen

 Einloggen
Einloggen
